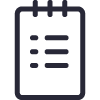WALHALLA Fachverlag
Der WALHALLA Fachverlag ist mit klassischen Loseblatt- und Buchprodukten sowie elektronischen Publikationen (CD-ROMs, Online-Dienste) führend im Bereich Recht, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung, Soziale Arbeit und Bundeswehr.
Wissen für die Praxis: Die Titel des WALHALLA Fachverlags bieten kompaktes Fachwissen für die täglichen Probleme und wertvolle Informationen zu den Grundlagen beruflichen Handelns. Akademisch-trockene Theorien haben Sie dabei nicht zu befürchten. Unsere Autoren bieten Ihnen konkrete Zahlen und harte Fakten. Fachlich auf neuestem Stand berücksichtigen sie gesellschaftliche Entwicklungen genauso wie wirtschaftliche Trends - übersichtlich, praxisorientiert und leicht verständlich.
WALHALLA-Titel sind für Menschen konzipiert, deren Zeit kostbar ist. Für Leser, die die Unterstützung professioneller Experten suchen. Kurzum für Menschen, die weiterkommen wollen.
Zum Nachwuchs im öffentlichen Dienst
Den Fachkräftemangel zu bewältigen und junge Menschen für eine Karriere in der Verwaltung zu begeistern, ist die zentrale Aufgabe des öffentlichen Dienstes in den kommenden Jahren.
Steigende Beschäftigtenzahlen im öffentlichen Dienst
Nach einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes vom 17. Juli 2025 wächst der öffentliche Dienst immer weiter. Rund 5,4 Millionen Menschen waren 2024 im Staatsdienst tätig, was 1,8 Prozent Zuwachs gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das entspricht einer Quote von 12 Prozent aller Erwerbstätigen.
Etwa eine Million Beschäftigte arbeiten an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, dem personalstärksten Aufgabenbereich. Die Zahl der Erzieherinnen und Erzieher hat sich in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt und liegt bei kommunalen Kindertagseinrichtungen bei etwa 290.000 Personen.
Strukturelle Probleme ungelöst
Volker Geyer, Vorsitzender des dbb (Gewerkschaft Beamtenbund und Tarifunion) relativiert diese Zahlen. Die ständig wachsenden Aufgaben, die die Verwaltung zu erledigen hat, gehören mitberücksichtigt, wie die gesetzliche Verankerung des Anspruchs auf Ganztagsbetreuung.
In praktisch allen Teilen des öffentlichen Dienstes herrsche Personalmangel, der zu verzeichnende Beschäftigtenzuwachs sei nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Nach dem dbb Monitor 2025 fehlen zurzeit 570.000 Beschäftigte, etwa 20.000 mehr als 2024.
Zudem gehen die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand. In den nächsten zehn Jahren verlassen über 1,4 Millionen Beschäftigte den öffentlichen Dienst. 2030 soll nach einer Hochrechnung jeder dritte Beschäftigte in Rente sein. Ungeklärt sei noch immer, wie diese Lücke geschlossen werden soll.
Spitzenplätze bei Ausbildungsvergütungen
Den Wettbewerb um Nachwuchskräfte braucht sich der Staat, was Ausbildungsvergütungen anbelangt, allerdings nicht zu scheuen.
In einer 2025 veröffentlichten Studie der Hans-Böckler-Stiftung liegen die Entgelte für Auszubildende des öffentlichen Dienstes in der Spitzengruppe. In Pflegeberufen zahlen Bund und Kommunen im ersten Ausbildungsjahr 1.416 Euro, in anderen Berufen 1.293 Euro. Bei den Ländern betragen die Vergütungen 1.381 Euro (Pflegeberufe) bzw. 1.237 Euro.
Tarifverträge tragen dazu bei, die Fachkräftebasis von morgen zu sichern, so das Ergebnis der Studie. In manchen Berufen ohne Tarifbindung erhalten Azubis lediglich die Mindestvergütung von 682 Euro im Monat.
Die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes für Auszubildende (TVA-L, TVAöD) können als Investition in die Zukunft gesehen werden, um die dringend benötigten qualifizierten und engagierten Nachwuchskräfte zu gewinnen und zu halten.
Berufe des öffentlichen Dienstes belegen Top-Plätze im Beruferanking, weshalb die Ausgangsposition nicht schlecht ist, die personellen Herausforderungen der kommenden Jahre zu bewältigen.
Jürgen Grünling, Walhalla Fachverlag
Bach-Terhorst
Tarifrecht der Nachwuchskräfte Länder
Tarifrecht der Nachwuchskräfte Länder
Vorschriften - Kommentar - Arbeitshilfen
ePA für alle
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist seit 29. April 2025 für alle gesetzlich Versicherten bundesweit ausgerollt. Sie soll die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranbringen. Die ePA ermöglicht es, medizinische Dokumente – wie Befunde, Arzneimittelpläne oder Arztbriefe – digital und sicher zentral zu speichern und für behandelnde Ärztinnen und Ärzte sowie andere Gesundheitsberufe gezielt freizugeben. Ziel ist eine bessere Vernetzung in der Versorgung, Vermeidung von Doppeluntersuchungen und mehr Transparenz für Patientinnen und Patienten.
Doch während die Akte formal bereits eingeführt ist, zeigt sich in der Praxis, dass die Umsetzung an vielen Stellen ins Stocken geraten ist.
Verzögerungen bei den Leistungserbringern
Ab dem 1. Oktober 2025 ist die ePA für alle Leistungserbringer verpflichtend. Allerdings ist die technische Umsetzung bei den Leistungserbringern komplex und langwierig: Viele Einrichtungen können die ePA erst 2026 flächendeckend nutzen, weil IT-Systeme angepasst, getestet und gesichert werden müssen. Laut einer Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts im Auftrag der Deutschen Krankenhausgesellschaft von Anfang September 2025 haben zwei Drittel der Krankenhäuser (66 Prozent) mit der Inbetriebnahme begonnen, aber nur etwa 20 Prozent haben diesen Prozess bislang vollständig abgeschlossen und stehen kurz vor einer internen Pilotierung. Knapp unter 60 Prozent der Einrichtungen gehen derzeit davon aus, dass die ePA erst im ersten oder zweiten Quartal 2026 krankenhausweit eingesetzt werden kann.
Keine Akzeptanz bei den Versicherten
Sorgen macht auch das Nutzungsverhalten der Versicherten: Obwohl etwa 79 Millionen ePAs angelegt wurden, nutzen laut Krankenkassen nur ein Bruchteil der Versicherten die Akte aktiv, etwa zur Dokumentensicht oder Datensperrung für Ärzte.
Die Gründe liegen unter anderem in komplizierten Anmelde- und Registrierungsprozessen, Unsicherheiten im Umgang mit den digitalen Anwendungen und Bedenken beim Datenschutz. Hinzu kommen technische Probleme: Einige Praxisverwaltungssysteme sind noch nicht voll kompatibel, die Bedienung der ePA-App ist für manche Nutzer wenig intuitiv, und Testmöglichkeiten für die Systeme waren teils unzureichend. Auch im medizinischen Alltag bestehen noch Unsicherheiten – zum Beispiel im Umgang mit Kinder- und Notfalldaten oder der Löschung falscher Diagnosen.
Fazit
Die elektronische Patientenakte ist ein zentrales Zukunftsprojekt des Gesundheitswesens – ihr Erfolg hängt jedoch davon ab, ob technische Hürden überwunden, Prozesse vereinfacht und das Vertrauen der Versicherten gestärkt werden.
Erst wenn die Ärtzeschaft und die Versicherten gleichermaßen von den Vorteilen profitieren, kann die ePA ihr Versprechen einer modernen, vernetzten und patientenzentrierten Versorgung wirklich einlösen.
Hauner
Ihre Patientenrechte im Gesundheitswesen
Ihre Patientenrechte im Gesundheitswesen
Ansprüche kennen und geltend machen: Vor, während und nach der Behandlung
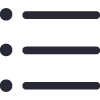
 BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS
BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS