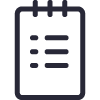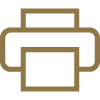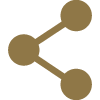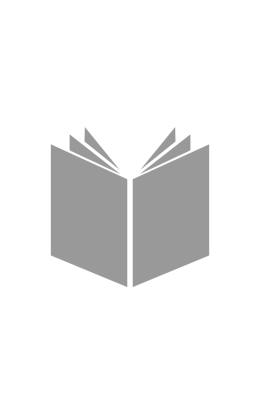
Intestinales Mikrobiom und Innere Medizin
2. Auflage
UNI-MED Verlag AG
ISBN 978-3-8374-5675-2
Standardpreis
Bibliografische Daten
eBook. PDF. Weiches DRM (Wasserzeichen)
2. Auflage. 2025
Umfang: 175 S.
Verlag: UNI-MED Verlag AG
ISBN: 978-3-8374-5675-2
Weiterführende bibliografische Daten
Das Werk ist Teil der Reihe: UNI-MED Science
Produktbeschreibung
1. Dynamik und Struktur des intestinalen Mikrobioms 17 1.1. Mikrobiota und Mikrobiom - einige Fakten 17 1.2. Struktur der humanen bakteriellen Mikrobiota 18 1.3. Pilze und Viren als Bestandteile der intestinalen Mikrobiota 22 1.4. Intestinale Mikrobiota als Ökosystem 24 1.5. Dynamik der Mikrobiota im Lebenszyklus 25 1.6. Beeinflussung der Struktur der Mikrobiota durch Ernährung 25 1.7. Beeinflussung der Struktur der Mikrobiota durch Antibiotika 27 1.8. Beeinflussung der Struktur der Mikrobiota durch Rauchen 27 1.9. Beeinflussung der Struktur der Mikrobiota durch Entzündung 27 1.10. Fazit 28 2. Das intestinale Mykobiom 30 2.1. Charakteristika und Funktion des humanen intestinalen Mykobioms 30 2.2. Das Mykobiom bei entzündlichen Darmerkrankungen 31 2.3. Einfluss des Mykobioms auf Lebererkrankungen 32 2.4. Mykobiom und Tumorerkrankungen 33 2.5. Ausblick 33 3. Das intestinale Virom 36 3.1. Charakteristika des humanen intestinalen Viroms 36 3.2. Phagen - Hauptbestandteile des humanen intestinalen Viroms 38 3.2.1. Phagen bei Erkrankungen der Darmbarriere 39 3.3. Humane endogene Retroviren (HERV) 40 3.3.1. HERV: potentielle Bedeutung bei inflammatorischen und malignen Erkrankungen 41 3.4. Weitere Assoziationen des Viroms mit Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen 42 3.5. Ausblick: das intestinale Virom in der Diagnostik und Therapie von Verdauungs- und Stoffwechselerkrankungen 43 4. Intestinales Mikrobiom und Schleimhautbarriere 45 4.1. Epithel und Mukus 45 4.2. Antibakterielle Peptide und angeborene Immunität 48 4.3. Adaptive Immunität 50 4.4. Fazit 51 5. Intestinales Mikrobiom und Schleimhautbarriere bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen 53 5.1. Intestinales Mikrobiom bei CED 53 5.2. Die Schleimhautbarriere bei CED 56 5.2.1. Mukus 56 5.2.2. Antibakterielle Peptide und angeborene Immunität 57 5.3. Adaptive Immunität 59 5.4. Mikrobiom bei CED: Henne oder Ei? 60 5.5. Fazit 61 6. Intestinales Mikrobiom bei Reizdarmsyndrom 64 6.1. Definition und Epidemiologie des Reizdarmsyndroms 64 6.2. Pathogenese 64 6.2.1. Intestinales Mikrobiom 64 6.2.1.1. Postinfektiöse Genese und Antibiotikagabe 65 6.2.1.2. Dysbiose 65 6.2.1.3. Therapeutische Intervention 66 6.2.2. Intestinales Metabolom 67 6.2.3. Störung der intestinalen Barriere 67 6.2.4. Sekretion und Motilität 67 6.2.5. Viszerale Sensitivität 68 6.2.6. Störung des enteralen Immungleichgewichts 68 6.2.7. Störung neurologischer und neuroimmunologischer Prozesse 68 6.2.8. Vererbung und Geburtsmodus 68 6.2.9. Genetik 69 6.2.10. Mikrobiom-Darm-Hirn-Achse 70 6.2.11. Ernährung 70 6.3. Zusammenfassung 72 7. Intestinales Mikrobiom bei Lebererkrankungen 75 7.1. Die Darm-Leber-Achse 75 7.1.1. Zusammensetzung des intestinalen Mikrobioms 75 7.1.2. Darmbarrierefunktion und Immunologie 76 7.1.3. Metabolom und Leberpathologien 77 7.2. Metabolische Dysfunktion-assoziierte steatotische Lebererkrankung 78 7.3. Alkoholische Lebererkrankung 79 7.4. Akute Leberzellschädigung 79 7.5. Leberzirrhose und ihre Komplikationen 79 8. Mikrobiom und Gallenwegserkrankungen 83 8.1. Das intestinale und biliäre Mikrobiom 83 8.1.1. Das intestinale und biliäre Mikrobiom 83 8.1.2. Das biliäre Mikrobiom 83 8.2. Gallensäure-Synthese und enterohepatischer Kreislauf 84 8.3. Einfluss des intestinalen Mikrobioms auf den Gallensäurestoffwechsel 85 8.3.1. Mikrobielle Dekonjugation von Gallensäuren 85 8.3.2. Mikrobielle Hydroxylierung von Gallensäuren zu sekundären Gallensäuren 85 8.3.3. Faktoren, die den bakteriellen Gallensäurestoffwechsel beeinflussen 86 8.4. Rolle des Mikrobioms für die enterohepatische Rezirkulation 86 8.5. Einfluss des Mikrobioms auf primär sklerosierende Cholangitis 87 8.5.1. Definition und Krankheitsbild 87 8.5.2. Rolle des gastrointestinalen Mikrobioms in PSC 87 8.5.3. Mikrobielle Produkte: Rolle der Gallensäuren in PSC 88 8.5.4. Rolle des biliären Mikrobioms bei PSC 89 8.5.5. Das Mikrobiom als therapeutisches Ziel für die PSC 89 8.6. Einfluss des Mikrobioms auf primär biliäre Cholangitis 89 8.7. Einfluss des Mikrobioms auf das Cholangiokarzinom 90 8.8. Einfluss des Mikrobioms auf die Cholelithiasis 91 8.8.1. Klassifizierung und Epidemiologie der Cholelithiasis 91 8.8.2. Die Rolle des Mikrobioms für die Pathogenese von Gallensteinen 91 9. Intestinales Mikrobiom bei Autoimmunerkrankungen 94 9.1. Wechselwirkungen zwischen Mikrobiom und Immunsystem 94 9.1.1. Intestinales Mikrobiom und das angeborene Immunsystem 95 9.1.2. Intestinales Mikrobiom und das erworbene Immunsystem 97 9.2. Rolle des intestinalen Mikrobioms bei ausgewählten Autoimmunerkrankungen 98 9.2.1. Rheumatoide Arthritis 98 9.2.2. Diabetes mellitus Typ 1 99 9.2.3. Multiple Sklerose 101 9.2.4. Systemischer Lupus erythematodes 102 9.2.5. Hashimoto-Thyreoiditis 103 9.2.6. Autoimmunhepatitis 104 9.3. Zusammenfassung 104 10. Intestinales Mikrobiom und Ernährung 109 10.1. Mikrobielle Gene kodieren für Verdauungsenzyme 109 10.2. Das Mikrobiom ist Spiegelbild von Ernährung und Lebensstil 111 10.3. "Microbiota-targeted nutritional therapy" 112 11. Intestinales Mikrobiom bei Adipositas und Diabetes 116 11.1. Prävalenz von Adipositas und Typ 2-Diabetes mellitus 116 11.2. Definition von Adipositas und Diabetes 117 11.3. Insulinresistenz bei der Entwicklung von Typ 2-Diabetes 117 11.4. Der Einfluss des Mikrobioms auf Typ 2-Diabetes 118 11.5. Ernährung und die mikrobiellen Stoffwechselprodukte 120 11.6. Einsatz von Probiotika bei der Prävention und Behandlung von Typ 2-Diabetes 121 11.7. Bariatrische Chirurgie und Mikrobiom 122 11.8. Schlussfolgerungen 123 12. Intestinales Mikrobiom und Atherosklerose 125 12.1. Komposition des Darm-Mikrobioms bei Atherosklerose 125 12.2. Dysbiose und Antibiotika 126 12.3. Mikrobielle Mechanismen bei der Atherogenese 126 12.3.1. Modulation des Fettstoffwechsels 127 12.3.2. Darmflora-abhängige Metabolite 128 12.3.2.1. Kurzkettige Fettsäuren 128 12.3.2.2. Trimethylamin-N-oxid (TMAO) 128 12.3.2.3. Mikrobielle Tryptophan-Metabolite 129 12.3.2.4. Weitere mikrobielle Metabolite 130 12.3.3. Metabolische Endotoxinämie 130 12.3.3.1. Leaky-Gut-Syndrom 131 12.3.4. Modulation des Immunsystems 131 12.3.4.1. Regulatorische T-Zell-/Th17-Zell-Balance 131 12.3.4.2. Klonale Hämatopoese 132 12.4. Atherothrombotisches Potential 132 13. Intestinales Mikrobiom und Malignome 135 13.1. Bakterien und Tumorgenese 135 13.1.1. Streptococcus gallolyticus 135 13.1.2. Fusobacterium nucleatum 136 13.1.3. Genotoxische pks+ Escherichia coli 137 13.2. Chronische Entzündung und Karzinogenese am Beispiel des enterotoxischen Bacteroides fragilis 137 13.3. Bakterielle Biofilme und kolorektales Karzinom 138 13.4. Sind mukosale Biofilme karzinogen? 138 13.5. Das Mikrobiom als Diagnostikum 139 13.6. Einfluss der intestinalen Mikrobiota auf die Tumortherapie 140 13.6.1. Immuntherapie 140 13.6.2. Chemotherapie 141 14. Antibiotika und intestinales Mikrobiom 144 14.1. Antibiotika-induzierte Veränderungen der Funktion und Komposition des intestinalen Mikrobioms 144 14.1.1. Bedeutung der Kolonisationsresistenz 144 14.1.2. Spezifische Einflüsse verschiedener Antibiotikaklassen 147 14.2. Einfluss auf die Immunhomöostase (Darm-Immun-Achse) 148 14.3. Fazit 149 15. Therapie des intestinalen Mikrobioms: Mikrobiomtransfer 151 15.1. Medico-legale Einordnung 151 15.2. Spenderscreening 151 15.3. Spenderwahl und -screening 154 15.4. Technische Durchführung 154 15.5. Indikationen 155 15.5.1. FMT bei C. difficile-Infektion 155 15.5.2. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen 156 15.5.3. Weitere Indikationen 156 16. Therapie des intestinalen Mikrobioms: Probiotika 159 16.1. Anforderungen und wünschenswerte Eigenschaften von Probiotika 159 16.2. Unerwünschte systemische Wirkungen und Verträglichkeit 160 16.3. Mechanismen der Wirkungen von Probiotika 161 16.3.1. Interaktionen zwischen Probiotika und dem autochthonen Mikrobiom des Wirts 161 16.3.2. Antibakterielle Eigenschaften von Probiotika und Schutz gegen Pathogene 161 16.3.3. Probiotika und die mukosale (epitheliale) Barriere 162 16.3.4. Probiotika und Immunmodulation 163 16.3.5. Sonstige Mechanismen probiotischer Aktivität 164 16.4. Klinische Indikationen für eine Therapie mit Probiotika 164 16.4.1. Chronisch entzündliche Darmkrankheiten 165 16.4.1.1. Colitis ulcerosa 165 16.4.1.2. Morbus Crohn 166 16.4.1.3. Pouchitis 166 16.4.1.4. Mikroskopische Kolitis (kollagene Kolitis/lymphozytäre Kolitis) 167 16.4.2. Reizdarmsyndrom/Funktionelle gastrointestinale Erkrankungen 167 16.4.3. Antibiotika-assoziierte Diarrhoe und C. difficile-Infektion 168 16.4.4. Divertikelkrankheit 168 16.4.5. Nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR)-induzierte Enteropathie 169 16.4.6. Probiotika in der Pädiatrie 169 16.4.7. Extraintestinale Erkrankungen 170 16.5. Die Zukunft der Probiotika 170 17. Abkürzungsverzeichnis 173 Index 174
Autorinnen und Autoren
Produktsicherheit
Hersteller
Uni-Med Verlag AG
Alten Eichen 2
28359 Bremen, DE
uni-med.buha@zeitfracht.de
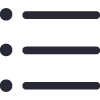
 BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS
BÜCHER VERSANDKOSTENFREI INNERHALB DEUTSCHLANDS